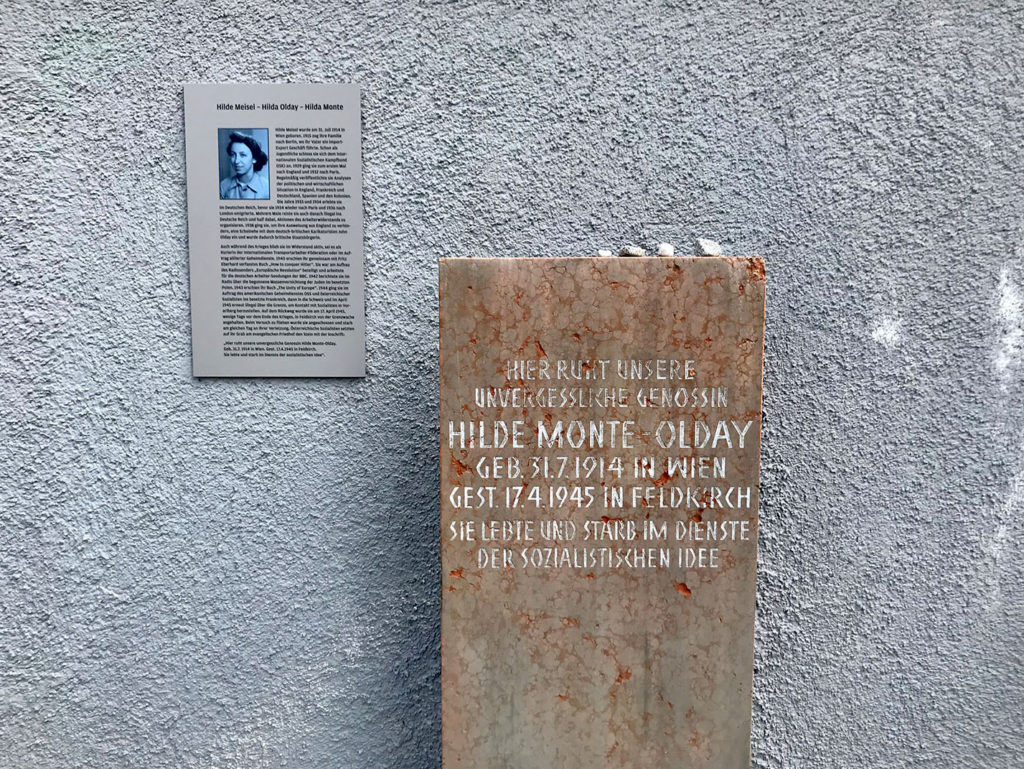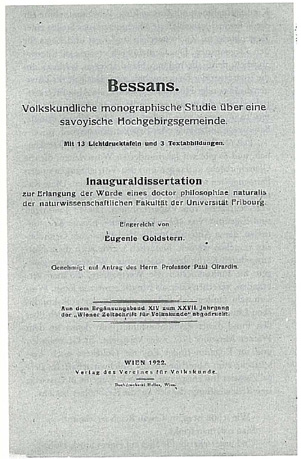Europäisches Tagebuch, 19. April 2023: heute vor 47 Jahren starb der Demokratietheoretiker und Verfassungsjurist Hans Kelsen in Kalifornien.
von Hanno Loewy
Hans Kelsen, der am 11. Oktober 1881 in Prag geboren wurde, war nicht, wie so oft behauptet, der alleinige „Autor“ der österreichischen Verfassung, jener Verfassung deren „Eleganz“ in letzter Zeit so oft bemüht worden ist. Aber der aus jüdischer Familie stammende Jurist hatte tatsächlich entscheidenden Einfluss auf ihren Text.
Kelsen studierte in Wien, und konvertierte 1905 erst zum katholischen Glauben, dann 1912 zum Protestantismus. Mit seinem Hauptwerk, der Reinen Rechtslehre, gehört er zu den Begründern des Rechtspositivismus, die sich von der sogenannten Naturrechtslehre abzusetzen versuchte. Ein Streit der Laien kaum verständlich war. Schließlich ging auch Kelsen von einer – jenseits der positiven Rechtssetzungen vorhandenen – „Grundnorm“ aus, die er zunächst als „Hypothese“, dann als „Fiktion“ bezeichnete. Und die ihn gleichwohl zum erklärten Anhänger von unveräußerlichen Menschenrechten machte.
 1917 wurde Kelsen Professor in Wien. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Hersch Lauterpacht, der sich allerdings vom Rechtspositivismus abwenden und als Anhänger der Naturrechtslehre zu einem der maßgeblichen Völkerrechtsexperten des 20. Jahrhunderts werden sollte.
1917 wurde Kelsen Professor in Wien. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem Hersch Lauterpacht, der sich allerdings vom Rechtspositivismus abwenden und als Anhänger der Naturrechtslehre zu einem der maßgeblichen Völkerrechtsexperten des 20. Jahrhunderts werden sollte.
Kelsen vertrat schon nach dem 1. Weltkrieg in seinen Arbeiten zum Verfassungsrecht eine Demokratietheorie, die auf dem Respekt und dem Schutz von Minderheitenrechten basierte: „Die für die Demokratie so charakteristische Herrschaft der Majorität unterscheidet sich von jeder anderen Herrschaft dadurch, daß sie eine Opposition — die Minorität — ihrem innersten Wesen nach nicht nur begrifflich voraussetzt, sondern auch politisch anerkennt und in den Grund- und Freiheitsrechten, im Prinzipe der Proportionalität schützt.“ Legendär ist sein Streit mit Carl Schmitt über die Frage ob der Macht des Souveräns oder dem Recht und dem Schutz von Minderheiten der Vorrang in einer demokratischen Gesellschaft gebührt.
Nach seiner entscheidenden Mitwirkung am Bundes-Verfassungsgesetz, dessen 100. Geburtstag in Österreich 2020 gefeiert wurde, blieb Kelsen Verfassungsrichter der jungen Republik. Und geriet bald ins Visier der nun folgenden konservativen Regierungen.
Um die Aufführung von Arthur Schnitzlers Theaterstück „Der Reigen“ sollte es im Februar 1921 in Wien zu einer antisemitisch aufgeladenen Kampagne kommen. Wiens sozialdemokratischer Bürgermeister Reumann weigerte sich das Stück, wie von der christlichsozialen Regierung gefordert, zu verbieten. Auch der Verfassungsgerichtshof entschied unter Kelsen gegen ein Verbot, was wiederum wütende Drohungen gegen Kelsen provozierte.
1929 schließlich kam es erneut zum Konflikt, der Kelsens Laufbahn in Österreich beendete. Das Verfassungsgericht hatte die bis dahin im katholischen Österreich verbotene Ehescheidung ermöglicht, indem sie die vom sozialdemokratischen Landeshauptmann Niederösterreichs eingeführte staatliche „Dispens-Ehe“ als rechtens anerkannte. Die christlichsoziale Bundesregierung setzte daraufhin das gesamt Verfassungsreicht per Gesetz ab und ernannte neue Richter.
Kelsen nahm Konrad Adenauers Angebot an, als Professor nach Köln zu wechseln. Doch schon 1933 machte die nationalsozialistische Machtübernahme in Deutschland seinem Wirken in Deutschland ein Ende. Als einziger seiner Kölner Fachkollegen beteiligte sich Carl Schmitt nicht an einer Petition zu seinen Gunsten.
Kelsen ging nach Genf, und 1936 nach Prag, wo seine Berufung einen Sturm völkisch-antisemitischer Studenten auslöste. 1940 emigrierte er in die USA, und ließ sich in Kalifornien nieder. 1945 ehrte ihn die Österreichische Akademie der Wissenschaften, doch eine Einladung, nach Österreich zurückzukehren ist nie erfolgt. An die Eleganz „seiner“ Verfassung wird gerne erinnert. Doch an den mühsamen Kampf um Minderheitenrechte weniger. Kelsen starb am 19. April 1976 in Orinda, Kalifornien.

Hans Kelsen: Büste am Sitz des Wiener Verfassungsgerichtshof