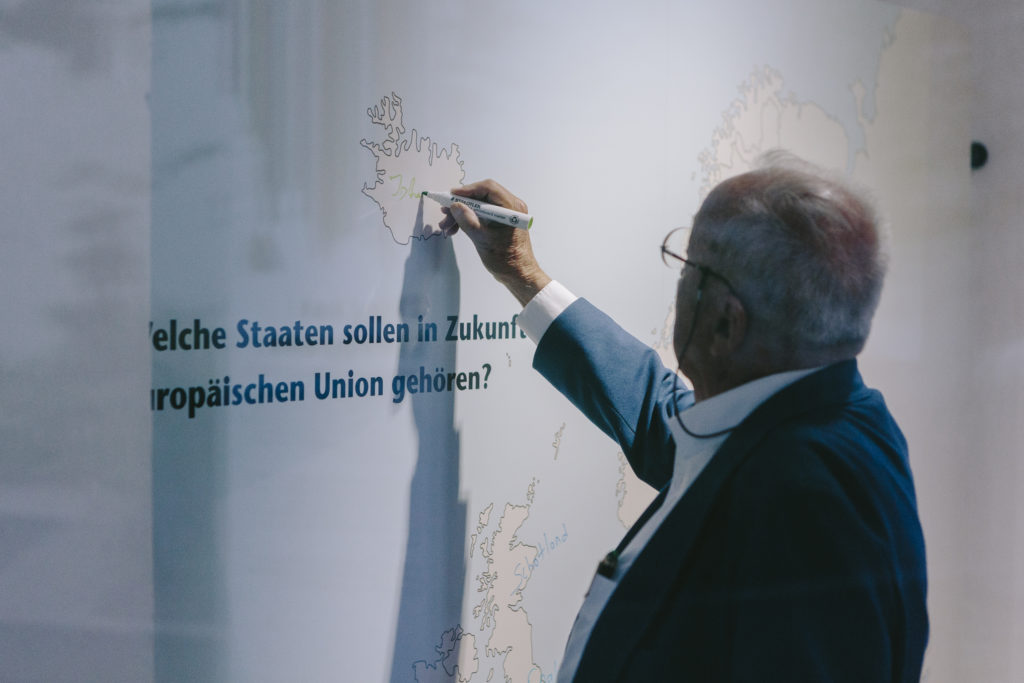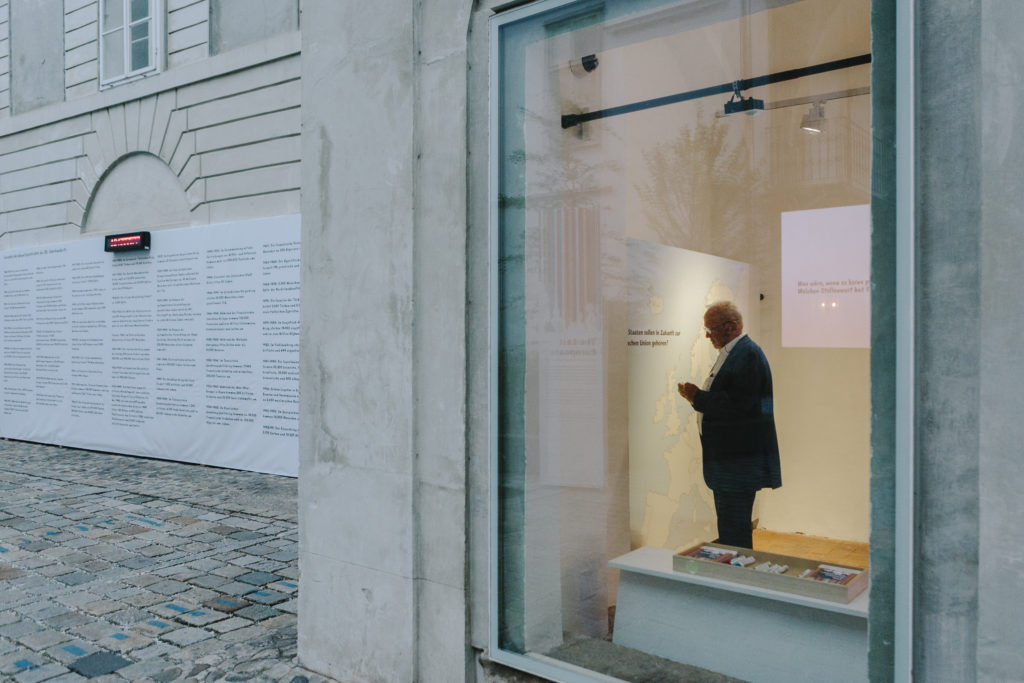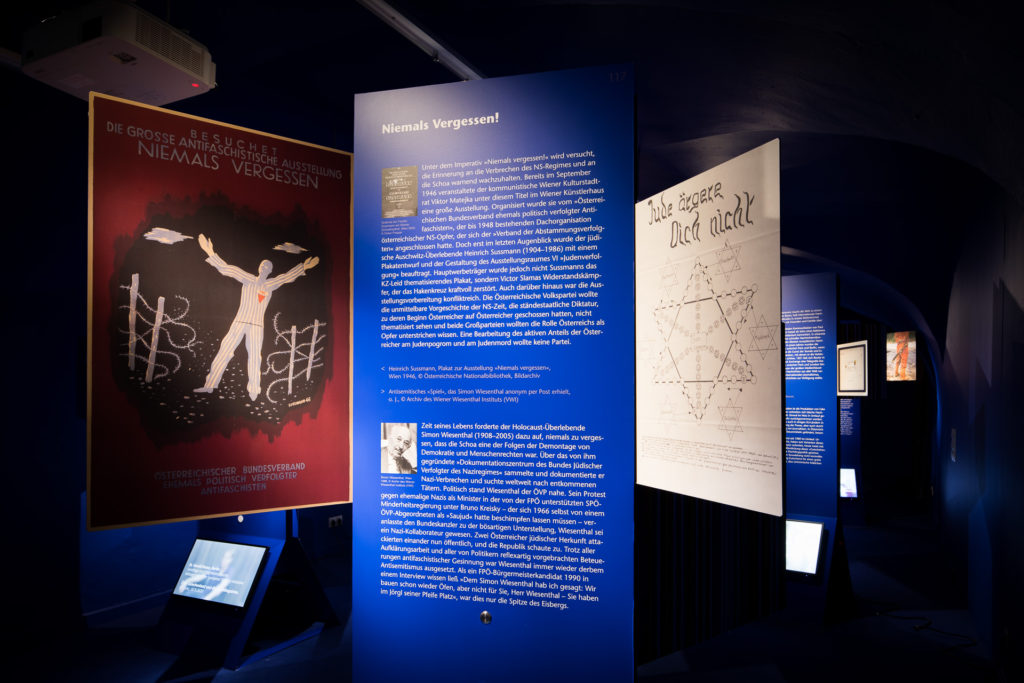Europäisches Tagebuch, 26.9.2020: Heute vor 80 Jahren nahm sich Walter Benjamin in Port Bou an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien das Leben. Er war auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, hatte die Grenze schon überwunden – und fürchtete, von den spanischen Grenzbeamten wieder ins besetzte Frankreich zurückgeschickt zu werden.
Wenige Monate zuvor, im Mai 1940, hatte er seinem Freund Stephan Lackner in Paris geschrieben:
„Man fragt sich, ob die Geschichte nicht im Begriff ist, eine geistreiche Synthese von zwei nietzscheanischen Begriffen zu schmieden, nämlich die des guten Europäers und die des letzten Menschen. Das könnte den letzten Europäer ergeben. Wir alle kämpfen darum, nicht zu einem solchen zu werden.“
Benjamins letzten bedeutender Text, seine Thesen über den Begriff der Geschichte, rettete Hannah Arendt für die Nachwelt. An seinen „Engel der Geschichte“ erinnert seit August in Hohenems, vor dem früheren Gasthaus Engelburg am Kreuzungspunkt der ehemaligen Judengasse und Christengasse, eine Skulptur von Günther Blenke. Inspiriert von dem Stück eines verbrannten Baumes, in den ein Blitz eingeschlagen ist.

Aufstellung der Brunnenplastik in Hohenems von Günther Blenke, am 8.8.2020. Foto: Julie Walser
In seinen „Thesen über den Begriff der Geschichte“ schrieb Walter Benjamin 1940:
„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“
Danke an Günther Blenke – und Franz Sauer, der das Fragment des verbrannten Baumes im Wald geborgen hat.

Günther Blenke, Franz Sauer und der “Engel der Geschichte”. Foto: Julie Walser